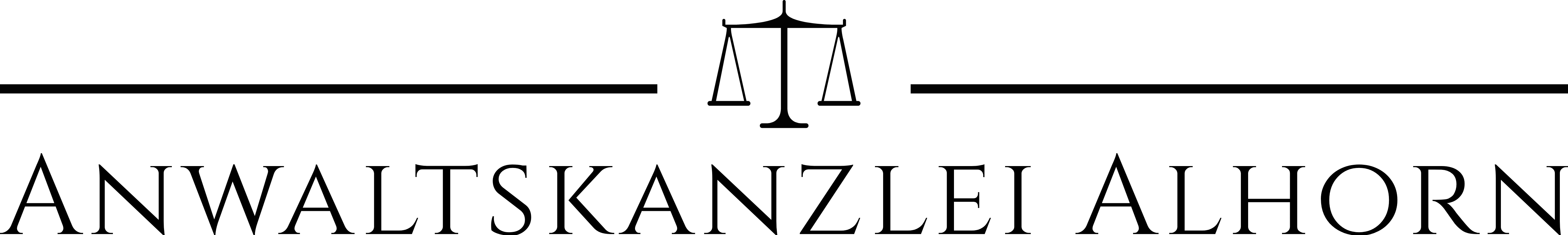Dashcams haben in den vergangenen Jahren Einzug in den Straßenverkehr gefunden. Sie sollen Unfallgeschehen dokumentieren und die Beweisführung erleichtern. Gleichwohl ist ihre rechtliche Zulässigkeit im deutschen Recht – insbesondere im Verkehrsrecht – umstritten. Zentral ist die Frage, ob Dashcam-Aufnahmen zur Durchsetzung von Ansprüchen nach einem Verkehrsunfall oder in verkehrsstrafrechtlichen Verfahren verwertbar sind.
Gesetzliche Ausgangslage
1. Zivilrechtliche Haftung im Straßenverkehr
Im Verkehrsrecht ist die Beweissicherung von zentraler Bedeutung. Nach einem Unfall gilt im Zivilverfahren die Darlegungs- und Beweislast für die haftungsbegründenden Umstände (§§ 823, 249 ff. BGB; § 7 StVG). Gerade bei Verkehrsunfällen steht häufig Aussage gegen Aussage. Dashcam-Aufnahmen versprechen hier eine objektive Klärung des Geschehens.
2. Datenschutzrechtliche Einordnung
Die Aufzeichnung des Straßenverkehrs erfasst Kennzeichen und Personen – mithin personenbezogene Daten i.S.d. Art. 4 Nr. 1 DSGVO. Eine permanente Aufzeichnung verstößt regelmäßig gegen die Grundsätze der Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO) und der Zweckbindung (Art. 5 Abs. 1 lit. b DSGVO).
Datenschutzrechtlich zulässig ist lediglich eine anlassbezogene, kurzfristige Speicherung (z.B. Loop-Aufnahme mit Überschreibfunktion), die nur im Kollisionsfall gesichert wird.
3. Ordnungswidrigkeitenrechtliche Aspekte
Die Datenschutzaufsichtsbehörden werten eine anlasslose Daueraufzeichnung als Verstoß gegen die DSGVO, der mit Bußgeldern geahndet werden kann (Art. 83 DSGVO). Autofahrer bewegen sich daher bei permanenter Aufzeichnung im ordnungswidrigkeitsrechtlichen Risiko.
Gerichtliche Verwertbarkeit
1. Zivilrechtliche Rechtssprechung
Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 15.05.2018 (VI ZR 233/17) klargestellt, dass Dashcam- Aufnahmen im Zivilprozess als Beweismittel zulässig sind. Zwar verstoße die permanente Aufzeichnung gegen Datenschutzrecht, dennoch überwiege im Prozess das Interesse an einer funktionierenden Rechtspflege und der materiellen Wahrheit. Somit können Geschädigte Dashcam-Aufnahmen in Haftungsprozessen nutzen, auch wenn ihre Fertigung rechtswidrig war.
2. Strafprozessuale Einordnung
Auch in Straf- und Bußgeldverfahren können Dashcam-Aufnahmen als Beweismittel herangezogen werden (§ 244 Abs. 2 StPO). Insbesondere bei Vorwürfen wie Nötigung im Straßenverkehr (§ 240 StGB) oder unerlaubtem Entfernen vom Unfallort (§ 142 StGB) können sie entscheidende Beweise liefern. Allerdings ist stets eine Abwägung zwischen Persönlichkeitsrecht und Aufklärungsinteresse vorzunehmen.
3. Verwaltungsrechtliche Implikationen
In Fahrerlaubnisverfahren oder Ordnungswidrigkeitenverfahren (z.B. Rotlicht- oder Geschwindigkeitsverstöße) haben Gerichte die Verwertung bislang nicht generell ausgeschlossen. Entscheidend bleibt, ob die Aufnahmen gezielt, dauerhaft und systematisch gefertigt wurden oder lediglich situationsbedingt.
Bewertung für die Praxis im Verkehrsrecht
- Unfallregulierung: Dashcams können eine erhebliche Beweiserleichterung bieten und werden von Gerichten anerkannt.
- Haftungsrecht: Versicherungen müssen Aufnahmen berücksichtigen, auch wenn diese datenschutzrechtlich problematisch sind.
- Strafrecht und Ordnungswidrigkeiten: Verwertbarkeit grundsätzlich möglich, jedoch immer mit Abwägung im Einzelfall.
- Risiko für Nutzer: Wer dauerhaft aufzeichnet, riskiert datenschutzrechtliche Sanktionen, bewegt sich aber in der Beweisführung oft auf sicherem Terrain.
Fazit
Im Verkehrsrecht hat sich die Verwertbarkeit von Dashcam-Aufnahmen vor Gericht durch die BGH-Rechtsprechung etabliert. Datenschutzrechtliche Bedenken bestehen weiterhin, sie stehen der gerichtlichen Nutzung aber nicht zwingend entgegen. Für Autofahrer ist entscheidend, Geräte mit Loop-Funktion einzusetzen, die nur kurze Sequenzen speichern, um sowohl den Anforderungen der DSGVO als auch der gerichtlichen Praxis gerecht zu werden. Damit bleibt die Dashcam ein rechtlich sensibler, in der Praxis aber zunehmend anerkannter Bestandteil der Beweissicherung im Straßenverkehr.